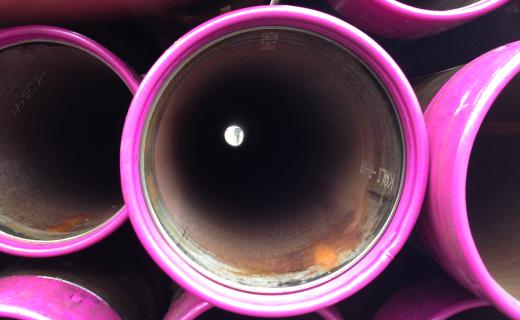Herzlich willkommen bei der Exterra Energy Service GmbH!
Die Exterra Energy Service GmbH ist eine Projektentwicklungs- und Projektfinanzierungsgesellschaft im Bereich der Tiefengeothermie.
Da Energie „ex terra“, Fokus unseres Tätigkeitsbereiches ist, entwickeln wir Geothermie Kraftwerksprojekte in Deutschland, der Schweiz und anderen europäischen Ländern, in welchen die Erschließung tiefengeothermaler Potentiale möglich ist.
Zur Entwicklung von Kraftwerken kooperiert die Exterra Energy Service GmbH mit den führenden Geologen, Ingenieuren, Versicherungsexperten und Bohrfirmen in Deutschland und anderen Ländern.
Wir haben wir Zugang zu den führenden Investoren und Finanzinstituten die im Bereich der Erneuerbare Energien und besonders im Bereich der Tiefengeothermie tätig sind. Dies ermöglicht uns, Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen nicht nur für unsere eigenen Projekte, sondern auch für andere Entwickler und Eigentümer von Geothermie Projekten und Anlagen zu arrangieren.
Projekte in der Umsetzung
Aktuelles
27.08.2021
Tiefe Geothermie
Prospektionskampagne am Genfer See
Zur Erkundung des geothermischen Potenzials findet aktuell im Rahmen des geothermischen Projekts "EnergeÔ La Côte" in der französischen Schweiz eine 2D-Seismik-Kampagne entlang des Genfer Sees in den Bezirken Nyon und Morges statt.
Weiterlesen
06.07.2021
Tiefe Geothermie
Schweiz: Neues Joint Venture zur Erkundung geothermischer Ressourcen für die Fernwärme
Das Schweizer Energieunternehmen Romande Energie, die Services industriels de Lausanne (SiL) und die Service Intercommunal de l'Electricité (SIE) haben das Gemeinschaftsunternehmen GEOOL SA gegründet, um hydrothermale Ressourcen in und um Lausanne zu erschließen.
Weiterlesen
24.06.2021
Tiefe Geothermie
Startschuss für neue Geothermieanlage zur Strom- und Wärmegewinnung in der Schweiz
Wie der Bohrtechnik- und Geothermiespezialist Daldrup & Söhne AG bekannt gab, wurde er von einem Konsortium in der Schweiz beauftragt, eine Bohrung für ein Geothermieprojekt im Rhonetal durchzuführen.
Weiterlesen
18.06.2021
Tiefe Geothermie
Schweizer Nationalrat verhindert geschlossen Förderstopp für erneuerbare Energien-Projekte
Der Nationalrat will auch nach 2022 den Ausbau der Windkraft, Wasserkraft, Biogasanlagen, Geothermie und Photovoltaik zur sauberen Stromgewinnung fördern. Sie sollen mit nun beschlossenen einmaligen Investitionsbeiträgen ab 2023 weiter unterstützt werden.
Weiterlesen
10.06.2021
Tiefe Geothermie
Neuer Geo-Lehrpfad in Holzkirchen: Mit Erklärungen zur Geothermie
Der neue „Geo-Lehrpfad Holzkirchen (GLH)“ verbindet ein wahres Naturerlebnis mit einem hervorragenden Bildungsangebot! Auf einer Länge von 35 Kilometern geben 24 Infotafeln Auskünfte über eine große Bandbreite an Geo-Themen in der Region: die landschaftsprägenden Einflüsse der letzten Eiszeit, Wald, Naturschutz, Landwirtschaft, Grundwassergewinnung und Geothermie.
WeiterlesenKooperationspartner

gec-co
Entscheidend für erfolgreiche Geothermie-Projekte ist eine fundierte Planung und Umsetzung. gec-co entwirft für Sie geothermische Strom- und Wärmeerzeugungsanlagen.

G.E.O.S. Ingenieurgesellschaft
Die G.E.O.S. Ingenieurgesellschaft zeichnet sich durch ein breites Leistungsprofil sowie eine interdisziplinäre und teamorientierte Arbeitsweise auf qualitativ höchstem Niveau aus. Auf dieser Grundlage können wir zum Nutzen des Kunden komplexe Leistungen anbieten. Die Kooperation mit weiteren Unternehmen und Hochschulen gewährleistet Effizienz und Knowhow-Zuwachs.
Wissenswertes
Über uns
Exterra Energy Service GmbH
Bavaria Filmplatz 7 Geb. 40
T: + 49 (0)89 6494 7200
T: + 49 (0)89 6494 7200
82031 Grünwald
E: info@exterra.energy